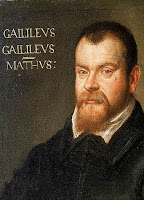
Die wissenschaftliche Publikation erschien gestern online, und schon heute berichtet die New York Times ausführlich darüber. Es geht um neue Befunde, die von erheblicher praktischer und auch ethischer Bedeutung sind. Untersucht wurde, ob sich bei Patienten Bewußtsein nachweisen läßt, bei denen ein Wachkoma diagnostiziert worden war.
Bei einem solchen Thema ist es wichtig, sich zunächst über die Begriffe zu verständigen. Definitionen findet man zum Beispiel bei der American Hospice Foundation und bei iMedix; ausführlich und auf wissenschaftlichem Niveau wird das Thema in der Scholarpedia behandelt:
Die Besonderheit des Wachkomas im Unterschied zu anderen Formen des Komas ist also hauptsächlich, daß der Patient einen Teil des Tags wach ist; aber nicht bei Bewußtsein. Man sagt, daß sein arousal weitgehend normal sei, es ihm aber an awareness fehle.Das Koma ist ein Zustand, in dem die Hirnrinde (Kortex) und/oder andere höhere Areale des Gehirns geschädigt sind mit der Folge, daß das Bewußtsein verlorengeht, daß der Patient nicht geweckt werden kann und daß er nicht auf Schmerzreize, Geräusche, Berührung und Licht reagiert. Die Schädigung kann reversibel (behebbar) oder irreversibel (nicht mehr behebbar) sein. Dieser Zustand kann in ein Wachkoma übergehen. Ein Wachkoma (vegetative state; Apallisches Syndrom) wird dann diagnostiziert, wenn die betreffende Person wach sein kann (sie hat einen, wenn auch oft gestörten, Schlaf- Wach- Rhythmus), aber keinerlei Bewußtsein hat. Ein Mensch im Wachkoma kann nicht mehr denken, mit seiner Umwelt Kontakt aufnehmen, geliebte Menschen erkennen. Er hat keine Gefühle mehr und spürt nicht, wie es ihm geht. Die höheren Ebenen des Gehirns funktionieren nicht mehr. Dauert dieser Zustand mindestens vier Wochen an, dann wird er als anhaltend (persistent) bezeichnet. Dauert er mehr als ein Jahr an, dann nennt man ihn permanent.
Soweit die gängigen Definitionen. Nun wirft das Konzept des Wachkomas aber sofort die Frage auf, woher man denn weiß, daß ein Mensch im Wachkoma nicht "denken" kann, daß er geliebte Personen nicht "erkennt", daß er keine "Gefühle mehr hat".
Die Antwort ist ernüchternd: Die Diagnose erfolgt in aller Regel nur aufgrund des Verhaltens des Patienten. Dazu die deutsche "Wikipedia":
Die Feststellung eines apallischen Syndroms hat in erster Linie klinisch zu erfolgen, also durch persönliche Untersuchung und Beobachtung des Betroffenen. Voraussetzung ist eine ausreichende Erfahrung der untersuchenden Person in der Beurteilung schwerer neurologischer Defektsyndrome. Weiterhin ist ein Beobachtungszeitraum von zumeist Wochen und Monaten zu fordern.Ein Wachkoma wird also dann diagnostiziert, wenn das in der Definition beschriebene Verhalten vorliegt (keine Reaktion auf geliebte Personen usw.). Abzusichern versucht man die Diagnose dadurch, daß man klassische Methoden der Hirnstrom- Analyse einsetzt. Evozierte Potentiale sind langsame Potentialschwankungen, die als Reaktionen auf Sinnesreize auftreten, zum Beispiel auf Hautreize (SEP) und akustische Reize (AEP).
Unterstützend ist eine apparative Diagnostik sinnvoll. Dazu gehören Kernspintomographie, EEG und Evozierte Potentiale (SEP, eventuell auch AEP und ereigniskorrelierte Potentiale). (...) Keine dieser Untersuchungen ist allein geeignet, die Diagnose zu stellen.
Solche evozierten Potentiale fehlen allerdings bei Patienten, bei denen ein Wachkoma diagnostiziert wird, nicht vollständig. Sie sind lediglich verlangsamt oder treten schwächer auf. Sogar eine Komponente, die mit Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht wird, die P300, kann auftreten; zum Beispiel dann, wenn man den Patienten mit seinem Namen anspricht.
Derselbe Patient zeigt aber in seinem Verhalten kein Anzeichen von Bewußtsein. Man kann das so interpretieren - und tut es in der Regel -, daß das Gehirn auf den eigenen Namen reagieren kann, auch wenn der Patient nicht bei Bewußtsein ist.
Was aber, wenn das Verhalten uns gar nicht verrät, ob der Patient bei Bewußtsein ist? Wenn die Motorik schwer geschädigt ist, dann kann sich der Patient möglicherweise nicht mitteilen, auch wenn er bei Bewußtsein ist. Mit dieser Frage befaßt sich die Untersuchung, über die heute die New York Times berichtet.
Die Originalarbeit ist nicht nur als Zusammenfassung, sondern auch im Original im Web zu lesen, und zwar in der Internet- Ausgabe des New England Journal of Medicine.
Sie hat, wie es in der Medizin üblich ist, zahlreiche Autoren (hier acht) aus zwei Ländern; England und Belgien. Die beiden Hauptautoren sind Martin M. Monti und Audrey Vanhaudenhuyse. So viele Autoren, tätig an verschiedenen Krankenhäusern, waren erforderlich, weil man eine vergleichsweise große Zahl von Patienten - es waren 54 - untersuchen wollte.
Um zu ermitteln, ob bei einem Patienten Bewußtsein nachweisbar war, verwendeten die Autoren eine Methode, die heute leider, weil sie teuer ist und viele Krankenhäuser nicht über sie verfügen, noch nicht klinischer Standard ist: Die Untersuchung der Hirntätigkeit in bestimmten Arealen mit Hilfe der Kernspin- Tomografie (fMRI); siehe Was tut unser Hirn, wenn wir nichts tun?; ZR vom 10. 7. 2009, sowie Was die Konferenz von Kopenhagen mit der Hirnforschung zu tun hat; ZR vom 8. 12. 2009.
Wenn jemand sich vorstellt, daß er sich bewegt, dann zeigt fMRI erhöhte Aktivität im supplementären motorischen Kortex. Wenn er sich etwas Räumliches vorstellt, dann zeigt ein anderes Areal erhöhte Aktivität, ein Areal nahe dem Hippocampus. Daß das in der Tat so ist und mittels fMRI erfaßt werden kann, klärten die Untersucher zunächst anhand von 16 gesunden Versuchspesonen.
Dann verwendeten sie diese Methode an den 54 Patienten, die entweder als im Wachkoma befindlich oder als im Zustand minimalen Bewußtseins (minimal consciousness) diagnostiziert worden waren. Den Patienten wurde entweder gesagt, sie sollten sich vorstellen, wie sie eine bestimmte Körperbewegung (das Schwingen eines Tennisschlägers) ausführen oder wie sie durch eine Stadt oder Räume wandern.
Bei den gesunden Versuchspersonen hatte es, wie zu erwarten, bei der Tennisschläger- Aufgabe erhöhte Aktivität im supplementären motorischen Kortex und bei der Wander- Aufgabe erhöhte Aktivität in der Nähe des Hippocampus gegeben. Würde sich das auch bei Patienten finden, dann wäre das ein Beleg dafür, daß sie die Aufgabe verstanden hatten und in der Lage waren, diese Instruktion in Vorstellungen umzusetzen; daß sie also bei Bewußtsein waren.
Bei fünf der 54 Patienten war das der Fall. Vier von ihnen waren als im Wachkoma befindlich diagnostiziert worden; beim fünften hatte die Diagnose "minimales Bewußtsein" gelautet.
Bei einem der Patienten, der mit dieser Methode besonders stabile Anzeichen von Bewußtsein gezeigt hatte, gingen die Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Sie stellten eine Reihe von persönlichen Fragen (zum Beispiel: Heißt Ihr Vater Alexander?) und gaben ihm die Instruktion, ein "ja" zu signalisieren, indem er sich die Armbewegung vorstellte und ein "nein", indem er sich die Wanderung vorstellte. Bei fünf von sechs Fragen "antwortete" der Patient richtig.
Beit allen 54 Patienten waren nur aufgrund der Beobachtung ihres Verhaltens (also ihrer Unfähigkeit, durch Reaktionen Bewußtsein zum Ausdruck zu bringen) die Diagnose "Wachkoma" oder "minimales Bewußtsein" gestellt worden.
Um zu ermitteln, ob bei einem Patienten Bewußtsein nachweisbar war, verwendeten die Autoren eine Methode, die heute leider, weil sie teuer ist und viele Krankenhäuser nicht über sie verfügen, noch nicht klinischer Standard ist: Die Untersuchung der Hirntätigkeit in bestimmten Arealen mit Hilfe der Kernspin- Tomografie (fMRI); siehe Was tut unser Hirn, wenn wir nichts tun?; ZR vom 10. 7. 2009, sowie Was die Konferenz von Kopenhagen mit der Hirnforschung zu tun hat; ZR vom 8. 12. 2009.
Wenn jemand sich vorstellt, daß er sich bewegt, dann zeigt fMRI erhöhte Aktivität im supplementären motorischen Kortex. Wenn er sich etwas Räumliches vorstellt, dann zeigt ein anderes Areal erhöhte Aktivität, ein Areal nahe dem Hippocampus. Daß das in der Tat so ist und mittels fMRI erfaßt werden kann, klärten die Untersucher zunächst anhand von 16 gesunden Versuchspesonen.
Dann verwendeten sie diese Methode an den 54 Patienten, die entweder als im Wachkoma befindlich oder als im Zustand minimalen Bewußtseins (minimal consciousness) diagnostiziert worden waren. Den Patienten wurde entweder gesagt, sie sollten sich vorstellen, wie sie eine bestimmte Körperbewegung (das Schwingen eines Tennisschlägers) ausführen oder wie sie durch eine Stadt oder Räume wandern.
Bei den gesunden Versuchspersonen hatte es, wie zu erwarten, bei der Tennisschläger- Aufgabe erhöhte Aktivität im supplementären motorischen Kortex und bei der Wander- Aufgabe erhöhte Aktivität in der Nähe des Hippocampus gegeben. Würde sich das auch bei Patienten finden, dann wäre das ein Beleg dafür, daß sie die Aufgabe verstanden hatten und in der Lage waren, diese Instruktion in Vorstellungen umzusetzen; daß sie also bei Bewußtsein waren.
Bei fünf der 54 Patienten war das der Fall. Vier von ihnen waren als im Wachkoma befindlich diagnostiziert worden; beim fünften hatte die Diagnose "minimales Bewußtsein" gelautet.
Bei einem der Patienten, der mit dieser Methode besonders stabile Anzeichen von Bewußtsein gezeigt hatte, gingen die Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Sie stellten eine Reihe von persönlichen Fragen (zum Beispiel: Heißt Ihr Vater Alexander?) und gaben ihm die Instruktion, ein "ja" zu signalisieren, indem er sich die Armbewegung vorstellte und ein "nein", indem er sich die Wanderung vorstellte. Bei fünf von sechs Fragen "antwortete" der Patient richtig.
Beit allen 54 Patienten waren nur aufgrund der Beobachtung ihres Verhaltens (also ihrer Unfähigkeit, durch Reaktionen Bewußtsein zum Ausdruck zu bringen) die Diagnose "Wachkoma" oder "minimales Bewußtsein" gestellt worden.
Bei 49 von ihnen lieferte auch fMRI keinen Hinweis auf Bewußtsein. Knapp zehn Prozent der Patienten aber konnten sich zwar nicht äußern, waren aber offenbar dennoch bei Bewußtsein; jedenfalls zu der Zeit, als sie von den Autoren untersucht wurden. Das ist ein beklemmendes Ergebnis.
Erfahrene Kliniker raten Angehörigen solcher Patienten oft, sich ihnen liebevoll zu widmen, mit ihnen zu sprechen, sie zu streicheln und dergleichen. Oft hat man das als einen Ratschlag abgetan, der lediglich den Angehörigen würde helfen können, mit der Situation umzugehen. Die jetzt publizierten Daten weisen aber deutlich darauf hin, daß jemand, der scheinbar im Wachkoma ist, unter Umständen sehr wohl denken, fühlen und sogar zielgerichtet innerlich handeln kann, auch wenn sein äußeres Verhalten davon nichts ahnen läßt.
Erfahrene Kliniker raten Angehörigen solcher Patienten oft, sich ihnen liebevoll zu widmen, mit ihnen zu sprechen, sie zu streicheln und dergleichen. Oft hat man das als einen Ratschlag abgetan, der lediglich den Angehörigen würde helfen können, mit der Situation umzugehen. Die jetzt publizierten Daten weisen aber deutlich darauf hin, daß jemand, der scheinbar im Wachkoma ist, unter Umständen sehr wohl denken, fühlen und sogar zielgerichtet innerlich handeln kann, auch wenn sein äußeres Verhalten davon nichts ahnen läßt.
© Zettel. Für Kommentare bitte hier klicken. Titelvignette: Galileo Galilei, gemalt im Jahr 1605 von Domenico Robusti. Ausschnitt.