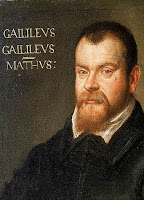
Der englische Begriff "default" ist oft schwer zu übersetzen. In der ursprünglichen Wortbedeutung ist ein Mangel gemeint; das lateinische falsum steckt darin, das Falsche. Heute begegnen wir dem Begriff aber meist in Bezeichnungen wie default settings. Das sind diejenigen Einstellungen, die ein System wählt, wenn der Nutzer nicht aktiv etwas anderes einstellt.
Seit ein paar Jahren gibt es Hinweise darauf, daß auch das Gehirn etwas von dieser Art kennt - einen default mode, eine Funktionsweise, die sich dann selbsttätig einstellt, wenn wir keiner speziellen Tätigkeit nachgehen; wenn wir keine Aufgabe zu erledigen haben. In seiner aktuellen Ausgabe berichtet darüber Science News.
Die Untersuchungen, die dort beschrieben werden, sind nicht nur für sich selbst interessant, sondern sie sind auch in doppelter Hinsicht repräsentativ für die heutige Hirnforschung: Zum einen, was die Methoden angeht, die diese Forschung in den vergangenen dreißig Jahren revolutioniert haben. Zum anderen zeigt das Konzept des default mode, wie grundlegend sich im letzten halben Jahrhundert die Vorstellungen von der funktionellen Architektur des Gehirns geändert haben.
Um das frühere Bild vom Gehirn und um die methodischen Forschritte geht es in diesem ersten Teil des Artikels.
Im zweiten Teil, der in den nächsten Tagen folgt, berichte ich - vor dem Hintergrund des heutigen Bilds von der funktionellen Architektur des Gehirns - über den default mode und seine Bedeutung; für die Alzheimer'sche Krankheit zum Beispiel, für Depression und Schizophrenie.
Wer in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Neurophysiologie studierte, der bekam ungefähr dieses Bild vom Gehirn vermittelt: Es gleicht einer Schaltzentrale (switchboard), wie es sie damals im Telefonnetz gab. Äußere Reize lösen Nervenimpulse aus, die über eine Reihe von Schaltstationen weitergeleitet werden, bis sie schließlich eine äußere Reaktion bewirken.
Von einigen dieser Schaltstationen wußte man etwas; zum Beispiel von den sogenannten primären Rindenarealen, in denen getrennt visuelle, auditive usw. Reize verarbeitet werden, und von den Arealen, die benötigt werden, um Bewegungen zu steuern. Die einen (die "sensorischen") Areale liegen hinten im Gehirn, die anderen (die "motorischen" Areale) eher weiter vorn.
Die Erregung wird also, so dachte man es sich, von hinten nach vorn im Gehirn "weitergeleitet" und auf diesem Weg irgendwie bearbeitet, umgeschaltet, aus einem sensorischen in ein motorisches Format übertragen.
Wo und wie das geschieht, davon hatte man kaum eine Vorstellung. Die Areale zwischen den sensorischen und den motorischen Arealen hießen "Assoziationsfelder", was besagte, daß man kaum etwas von ihnen wußte. Irgendwie bewerkstelligten sie diese Umschaltungen.
Was das einzelne Areal tat, davon konnte man allein dadurch eine grobe Vorstellung zu gewinnen versuchen, daß man Menschen untersuchte, die - etwa aufgrund einer Kopfverletzung - dort eine Störung hatten; im Tierversuch stellte man das nach, indem man dem Versuchstier solche Verletzungen gezielt beibrachte.
Auf diese Weise - auf diese im doppelten Wortsinn grobe Weise - fand man heraus, daß beispielsweise die Hirnareale hinter der Stirn - das Frontalhirn - etwas mit der Planung von Handlungen zu tun haben und mit der Fähigkeit, seine Handlungen gemäß einem Plan zu kontrollieren. Eine Verletzung in diesem Bereich führt dazu, daß der betreffende Mensch planlos und ungesteuert handelt; daß ein Versuchstier seinen Impuls, sofort auf einen Reiz zu reagieren, nicht mehr kontrollieren kann.
Es mußte also wohl in dieser Schaltzentrale, als die man sich das ganze Hirn vorstellte, so etwas wie eine übergeordnete Super- Schaltzentrale geben; einen Central Executive, einen Ober- Manager. Manche brachten das gar mit dem Bewußtsein in Zusammenhang. Der kleine Homunculus, der das große Gehirn steuert.
Das heutige Bild vom Gehirn ist radikal anders. Es unterscheidet sich von dieser "Schaltzentrale" mit ihrer im Frontalhirn eingebauten eigenen kleinen Steuerzentrale mindestens so sehr, wie sich das Telefonnetz der Deutschen Reichspost in den dreißiger Jahren, als das "Fräulein vom Amt" die Verbindungen stöpselte, von heutigen Handy- Netzen unterscheidet.
Die gewaltigen Fortschritte dieses halben Jahrhunderts sind, wie die meisten wissenschaftlichen Fortschritte, methodischen Durchbrüchen zu verdanken. Es werden - das ist fast immer die Grundlage - Verfahren entwickelt, die es erlauben, genauer hinzusehen. Nicht Theorien treiben die Forschung voran, sondern Meßinstrumente.
In der Astronomie waren es die immer besseren optischen Teleskope und ihre Ergänzung durch Geräte, die elektromagnetische Wellen außerhalb des sichtbaren Spektrums registrieren (z.B. Radioteleskope), die den Fortschritt brachten; dann Teleskope in der Erdumlaufbahn und Raumsonden. In der Hirnforschung waren es vor allem zwei methodische Entwicklungen:
Erstens lernte man, die Aktivität einzelner Nervenzellen (Neurone) mit Hilfe von Mikro- Elektroden zu registrieren, die ins Gehirn eingeführt werden (Einzelzellableitung). Anfangs waren das sehr grobe Messungen gewesen; man stocherte bei einem Versuchstier mehr oder weniger planlos in einem Areal herum, in der Hoffnung, eine Zelle zu finden, die etwas zu "sagen hatte". Die also aktiv wurde, wenn etwas Bestimmtes passierte - sagen wir, wenn ein dunkler Fleck das Gesichtsfeld eines Froschs durchquerte.
Inzwischen kann man von vielen (gegenwärtig bis zu fünfzig) solchen "implantierten" Elektroden gleichzeitig ableiten und dadurch untersuchen, wie Neurone im Verbund miteinander reagieren. Und längst hat man nicht mehr nur Zellen gefunden, die auf einen Fleck ansprechen; sondern zum Beispiel solche, die nur dann richtig aktiv werden, wenn das Versuchstier das Gesicht eines Artgenossen sieht.
Zweitens lernte man, die Tätigkeit des Gehirns von außen zu messen; mittels sogenannter nicht- invasiver Methoden; also ohne mit Elektroden ins Gehirn einzudringen.
Die älteste dieser Methoden geht auf das klassische EEG zurück, das die mit Gehirnaktivität einhergehenden Schwankungen elektrischer Potentiale aufzeichnet. In den sechziger Jahren wurde entdeckt, daß im scheinbar erratischen Auf und Ab des EEG - einem, sieht man von den Frequenzen ab, zufälligen Rauschen - langsame Potentialschwankungen versteckt sind, die sichtbar werden, wenn man dieses Rauschen herausrechnet, indem man viele Ableitungen unter identischen Bedingungen mittelt.
Man sieht dann Ereigniskorrelierte Potentiale, deren Komponenten viel darüber verraten, was gerade im Gehirn vorgeht - ob zum Beispiel Information aus dem Auge verarbeitet, ob eine Bewegung vorbereitet wird oder auch, ob das Gehirn eine Unstimmigkeit entdeckt. Hier sehen Sie ein Beispiel:

Die untere Kurve findet man, wenn jemand einen normalen Satz liest wie "Ich aß die Praline zum Tee". Ganz anders reagiert das Gehirn auf einen semantisch inkonsistenten Satz wie "Ich aß die Praline zum Kebap".
Leitet man gleichzeitig von Elektroden ab, die über die ganze Schädeloberfläche verteilt sind, dann kann man auch grob ermitteln, wo diese Prozesse jeweils stattfinden. Sehr viel genauer gelingt das mit den sogenannten Bildgebenden Verfahren.
Sie basieren auf einem einfachen Prinzip, das aber auf raffinierte Weise umgesetzt wird: Je aktiver eine Region des Gehirns ist, umso mehr Sauerstoff und Glukose benötigt sie, also umso mehr Zufuhr sauerstoffreichen Bluts. Das Gehirn verfügt über außerordentlich leistungsfähige Rückmeldekreise, über die diese Anpassung vorgenommen wird; und zwar innerhalb von nur einer bis fünf Sekunden.
Kann man also die Verteilung sauerstoffreichen Bluts im Gehirn messen, dann sieht man, wo es erhöhte Aktivität gibt.
Anfangs - ab den siebziger Jahren - nahm man diese Messung vor, indem man das Blut leicht radioaktiv markierte und dann die (minimale) Strahlung maß (PET).
Heute ist die interessanteste Methode das fMRI, in Deutschland meist als Kernspintomografie bezeichnet. Dabei wird von dem Umstand Gebrauch gemacht, daß die Moleküle des Hämoglobins in sauerstoffreichem und in sauerstoffarmem Blut unterschiedlich reagieren, wenn in einem Magnetfeld plötzliche Änderungen vorgenommen werden.
Diese Methoden liefern Bilder wie dieses:

Zu sehen ist ein (im Computer erzeugter) horizontaler Schnitt durch das Gehirn. Das fMRI wurde unter zwei Bedingungen gemessen: Wenn die Versuchspersonen nur eine schwarze Fläche sahen oder wenn sie einem sich bewegenden Objekt mit den Augen folgten. Die Areale, in denen die Blutzufuhr in dieser zweiten Bedingung erhöht war, sind orange markiert. Es sind just diejenigen Areale, von denen man aufgrund anderer Forschungen erwarten konnte, daß sie der visuellen Informationsverarbeitung dienen.
Nicht wahr, das ist spannend? Ohne ins Gehirn einzudringen kann man hineinblicken.
Man sieht, in welchen Arealen etwas im Gang ist; man sieht den zeitlichen Verlauf der Aktivität im Gehirn. Und was lernt man nun daraus über die Prozesse, die sich abspielen?
Es ist ist immer noch herzlich wenig; diese Forschung ist ja noch kein halbes Jahrhundert alt. Aber jedenfalls zeichnet sich ein ganz anderes Bild vom Gehirn ab, als es am Beginn dieses halben Jahrhunderts bestand. Darüber mehr im zweiten Teil; und über den default mode des Gehirns.
Seit ein paar Jahren gibt es Hinweise darauf, daß auch das Gehirn etwas von dieser Art kennt - einen default mode, eine Funktionsweise, die sich dann selbsttätig einstellt, wenn wir keiner speziellen Tätigkeit nachgehen; wenn wir keine Aufgabe zu erledigen haben. In seiner aktuellen Ausgabe berichtet darüber Science News.
Die Untersuchungen, die dort beschrieben werden, sind nicht nur für sich selbst interessant, sondern sie sind auch in doppelter Hinsicht repräsentativ für die heutige Hirnforschung: Zum einen, was die Methoden angeht, die diese Forschung in den vergangenen dreißig Jahren revolutioniert haben. Zum anderen zeigt das Konzept des default mode, wie grundlegend sich im letzten halben Jahrhundert die Vorstellungen von der funktionellen Architektur des Gehirns geändert haben.
Um das frühere Bild vom Gehirn und um die methodischen Forschritte geht es in diesem ersten Teil des Artikels.
Im zweiten Teil, der in den nächsten Tagen folgt, berichte ich - vor dem Hintergrund des heutigen Bilds von der funktionellen Architektur des Gehirns - über den default mode und seine Bedeutung; für die Alzheimer'sche Krankheit zum Beispiel, für Depression und Schizophrenie.
Wer in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Neurophysiologie studierte, der bekam ungefähr dieses Bild vom Gehirn vermittelt: Es gleicht einer Schaltzentrale (switchboard), wie es sie damals im Telefonnetz gab. Äußere Reize lösen Nervenimpulse aus, die über eine Reihe von Schaltstationen weitergeleitet werden, bis sie schließlich eine äußere Reaktion bewirken.
Von einigen dieser Schaltstationen wußte man etwas; zum Beispiel von den sogenannten primären Rindenarealen, in denen getrennt visuelle, auditive usw. Reize verarbeitet werden, und von den Arealen, die benötigt werden, um Bewegungen zu steuern. Die einen (die "sensorischen") Areale liegen hinten im Gehirn, die anderen (die "motorischen" Areale) eher weiter vorn.
Die Erregung wird also, so dachte man es sich, von hinten nach vorn im Gehirn "weitergeleitet" und auf diesem Weg irgendwie bearbeitet, umgeschaltet, aus einem sensorischen in ein motorisches Format übertragen.
Wo und wie das geschieht, davon hatte man kaum eine Vorstellung. Die Areale zwischen den sensorischen und den motorischen Arealen hießen "Assoziationsfelder", was besagte, daß man kaum etwas von ihnen wußte. Irgendwie bewerkstelligten sie diese Umschaltungen.
Was das einzelne Areal tat, davon konnte man allein dadurch eine grobe Vorstellung zu gewinnen versuchen, daß man Menschen untersuchte, die - etwa aufgrund einer Kopfverletzung - dort eine Störung hatten; im Tierversuch stellte man das nach, indem man dem Versuchstier solche Verletzungen gezielt beibrachte.
Auf diese Weise - auf diese im doppelten Wortsinn grobe Weise - fand man heraus, daß beispielsweise die Hirnareale hinter der Stirn - das Frontalhirn - etwas mit der Planung von Handlungen zu tun haben und mit der Fähigkeit, seine Handlungen gemäß einem Plan zu kontrollieren. Eine Verletzung in diesem Bereich führt dazu, daß der betreffende Mensch planlos und ungesteuert handelt; daß ein Versuchstier seinen Impuls, sofort auf einen Reiz zu reagieren, nicht mehr kontrollieren kann.
Es mußte also wohl in dieser Schaltzentrale, als die man sich das ganze Hirn vorstellte, so etwas wie eine übergeordnete Super- Schaltzentrale geben; einen Central Executive, einen Ober- Manager. Manche brachten das gar mit dem Bewußtsein in Zusammenhang. Der kleine Homunculus, der das große Gehirn steuert.
Das heutige Bild vom Gehirn ist radikal anders. Es unterscheidet sich von dieser "Schaltzentrale" mit ihrer im Frontalhirn eingebauten eigenen kleinen Steuerzentrale mindestens so sehr, wie sich das Telefonnetz der Deutschen Reichspost in den dreißiger Jahren, als das "Fräulein vom Amt" die Verbindungen stöpselte, von heutigen Handy- Netzen unterscheidet.
Die gewaltigen Fortschritte dieses halben Jahrhunderts sind, wie die meisten wissenschaftlichen Fortschritte, methodischen Durchbrüchen zu verdanken. Es werden - das ist fast immer die Grundlage - Verfahren entwickelt, die es erlauben, genauer hinzusehen. Nicht Theorien treiben die Forschung voran, sondern Meßinstrumente.
In der Astronomie waren es die immer besseren optischen Teleskope und ihre Ergänzung durch Geräte, die elektromagnetische Wellen außerhalb des sichtbaren Spektrums registrieren (z.B. Radioteleskope), die den Fortschritt brachten; dann Teleskope in der Erdumlaufbahn und Raumsonden. In der Hirnforschung waren es vor allem zwei methodische Entwicklungen:
Erstens lernte man, die Aktivität einzelner Nervenzellen (Neurone) mit Hilfe von Mikro- Elektroden zu registrieren, die ins Gehirn eingeführt werden (Einzelzellableitung). Anfangs waren das sehr grobe Messungen gewesen; man stocherte bei einem Versuchstier mehr oder weniger planlos in einem Areal herum, in der Hoffnung, eine Zelle zu finden, die etwas zu "sagen hatte". Die also aktiv wurde, wenn etwas Bestimmtes passierte - sagen wir, wenn ein dunkler Fleck das Gesichtsfeld eines Froschs durchquerte.
Inzwischen kann man von vielen (gegenwärtig bis zu fünfzig) solchen "implantierten" Elektroden gleichzeitig ableiten und dadurch untersuchen, wie Neurone im Verbund miteinander reagieren. Und längst hat man nicht mehr nur Zellen gefunden, die auf einen Fleck ansprechen; sondern zum Beispiel solche, die nur dann richtig aktiv werden, wenn das Versuchstier das Gesicht eines Artgenossen sieht.
Zweitens lernte man, die Tätigkeit des Gehirns von außen zu messen; mittels sogenannter nicht- invasiver Methoden; also ohne mit Elektroden ins Gehirn einzudringen.
Die älteste dieser Methoden geht auf das klassische EEG zurück, das die mit Gehirnaktivität einhergehenden Schwankungen elektrischer Potentiale aufzeichnet. In den sechziger Jahren wurde entdeckt, daß im scheinbar erratischen Auf und Ab des EEG - einem, sieht man von den Frequenzen ab, zufälligen Rauschen - langsame Potentialschwankungen versteckt sind, die sichtbar werden, wenn man dieses Rauschen herausrechnet, indem man viele Ableitungen unter identischen Bedingungen mittelt.
Man sieht dann Ereigniskorrelierte Potentiale, deren Komponenten viel darüber verraten, was gerade im Gehirn vorgeht - ob zum Beispiel Information aus dem Auge verarbeitet, ob eine Bewegung vorbereitet wird oder auch, ob das Gehirn eine Unstimmigkeit entdeckt. Hier sehen Sie ein Beispiel:

Die untere Kurve findet man, wenn jemand einen normalen Satz liest wie "Ich aß die Praline zum Tee". Ganz anders reagiert das Gehirn auf einen semantisch inkonsistenten Satz wie "Ich aß die Praline zum Kebap".
Leitet man gleichzeitig von Elektroden ab, die über die ganze Schädeloberfläche verteilt sind, dann kann man auch grob ermitteln, wo diese Prozesse jeweils stattfinden. Sehr viel genauer gelingt das mit den sogenannten Bildgebenden Verfahren.
Sie basieren auf einem einfachen Prinzip, das aber auf raffinierte Weise umgesetzt wird: Je aktiver eine Region des Gehirns ist, umso mehr Sauerstoff und Glukose benötigt sie, also umso mehr Zufuhr sauerstoffreichen Bluts. Das Gehirn verfügt über außerordentlich leistungsfähige Rückmeldekreise, über die diese Anpassung vorgenommen wird; und zwar innerhalb von nur einer bis fünf Sekunden.
Kann man also die Verteilung sauerstoffreichen Bluts im Gehirn messen, dann sieht man, wo es erhöhte Aktivität gibt.
Anfangs - ab den siebziger Jahren - nahm man diese Messung vor, indem man das Blut leicht radioaktiv markierte und dann die (minimale) Strahlung maß (PET).
Heute ist die interessanteste Methode das fMRI, in Deutschland meist als Kernspintomografie bezeichnet. Dabei wird von dem Umstand Gebrauch gemacht, daß die Moleküle des Hämoglobins in sauerstoffreichem und in sauerstoffarmem Blut unterschiedlich reagieren, wenn in einem Magnetfeld plötzliche Änderungen vorgenommen werden.
Diese Methoden liefern Bilder wie dieses:

Zu sehen ist ein (im Computer erzeugter) horizontaler Schnitt durch das Gehirn. Das fMRI wurde unter zwei Bedingungen gemessen: Wenn die Versuchspersonen nur eine schwarze Fläche sahen oder wenn sie einem sich bewegenden Objekt mit den Augen folgten. Die Areale, in denen die Blutzufuhr in dieser zweiten Bedingung erhöht war, sind orange markiert. Es sind just diejenigen Areale, von denen man aufgrund anderer Forschungen erwarten konnte, daß sie der visuellen Informationsverarbeitung dienen.
Nicht wahr, das ist spannend? Ohne ins Gehirn einzudringen kann man hineinblicken.
Man sieht, in welchen Arealen etwas im Gang ist; man sieht den zeitlichen Verlauf der Aktivität im Gehirn. Und was lernt man nun daraus über die Prozesse, die sich abspielen?
Es ist ist immer noch herzlich wenig; diese Forschung ist ja noch kein halbes Jahrhundert alt. Aber jedenfalls zeichnet sich ein ganz anderes Bild vom Gehirn ab, als es am Beginn dieses halben Jahrhunderts bestand. Darüber mehr im zweiten Teil; und über den default mode des Gehirns.
Für Kommentare bitte hier klicken. Titelvignette: Galileo Galilei, gemalt im Jahr 1605 von Domenico Robusti. Ausschnitt. Abbildungen: N400, vom Autor Schmierer in die Public Domain gestellt. fMRI, vom Autor Washington Irving in die Public Domain gestellt.