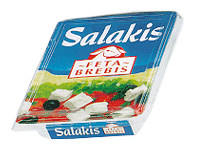
Jahrtausendelang basierte der Wohlstand von Städten, von Regionen, von Völkern darauf, daß sie etwas hatten, was die anderen nicht hatten, oder daß sie etwas konnten, was die anderen nicht oder nicht so gut konnten.
Was sie hatten: Erze, Bernstein, Salz beispielsweise. Was sie konnten: Den Bernstein zu Schmuck verarbeiten, das Salz sieden, die Erze verhütten.
Aber auch Schwerter schmieden in Damaskus, die Damaszener. Später Messer schmieden in Solingen, in Sheffield. Kuckucksuhren konstruieren und bauen im Schwarzwald, Gurken einlegen im Spreewald, Offiziersmesser herstellen in der Schweiz, Gruyère herstellen im Wallis, Gouda herstellen in Holland, Schafskäse herstellen im Aveyron, den Roquefort.
Und Schafskäse herstellen in Griechenland, den Feta.
Das alles herzustellen erfordert traditionellerweise große handwerkliche Sachkenntnis, ja Geheimwissen. Dieses wurde ängstlich gehütet; manchmal auch, wenn man Pech hatte, gestohlen. Auch vor Jahrtausenden, vor Jahrhunderten gab es schon eine Wissensgesellschaft; Wissen war immer eine entscheidende Produktivkraft.
Das Wissen um Verfahren, um Rezepturen spielt auch heute noch eine Rolle - sei es in Form der schon fast rührend anmutenden Coca-Cola-Geheimrezeptur, sei es in Gestalt von Patenten, die zwar nicht mehr geheim sind, deren Verwertungsrechte aber ähnliche Vorteile bedeuten wie früher das von Generation zu Generation tradierte Wissen darüber, wie man Schafsmilch zum Roquefort reifen läßt, oder zum Feta.
Zum Feta? Ja, und der ist das Thema dieses Beitrags, oder vielmehr der Salakis. Ich habe ihn vor Jahren in sozusagen zwiefacher Gestalt kennengelernt: Als ein sehr wohlschmeckender Schafskäse, und als Gegenstand einer Geschichte im "Nouvel Observateur".
Der berichtete damals über die Schafzüchter im Aveyron, deren Existenz auf dem Roquefort basiert, der in den Kellern und Höhlen der gleichnamigen Stadt reift. (Ich bin einmal dort gewesen; man riecht den Roquefort buchstäblich Kilometer vor der Stadt.) Sie erzeugen aber seit einiger Zeit, dank verbesserter Methoden und größerer Herden, mehr Schafsmilch, als zu Roquefort verarbeitet werden kann. Da hatten sie eine Idee: Sie verarbeiteten die überschüssige Schafsmilch zu Feta, also zu einem in einer Salzlake liegenden, in Scheiben geschnittenen Schafs-Halbfrischkäse. Und vermarkteten ihn unter der Marke Salakis.
So lernte ich ihn kennen und schätzen. Er ist milder als der bulgarische und korsische Schafskäse, hat aber trotzdem Geschmack und auch die richtige halbfeste Konsistenz. Schnittfest, nicht bröckelnd. Salakis auf frischem Brot, dazu ein paar Tropfen Olivenöl, Pfeffer, Oregano und in feine Scheibchen geschnittener Knoblauch - zusammen mit einem einfachen, kräftigen Wein (weiß oder rot, das ist egal) ist das eine Köstlichkeit, der ich nur wenige Genüsse an die Seite stellen kann.
Nur, Feta ist das demnächst nicht mehr. Griechenland hat erfolgreich geklagt, und mit Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2005, Az. C-465/02, ist es den Bauern des Aveyron, die den Salakis als Kooperative unter der Bezeichnung Feta verkauft hatten, untersagt, das ab 2007 noch zu tun. Der Salakis, den man im Augenblick zu kaufen bekommt, trägt bereits nicht mehr die Bezeichnung "Feta".
Seinem Geschmack hat das, soweit ich erkennen kann, nicht geschadet. So wenig, wie der in Holland erzeugte Emmentaler dadurch schlechter schmeckt, daß er als "Maasdamer" vermarktet wird. So wenig, wie ein Messer aus Chemnitz schlechter ist als eines aus Solingen. So wenig, wie wir noch Salz kaufen, weil aus einer Lüneburger Salzsiederei kommt, oder Pastillen, weil sie in Ems gedreht wurden.
Kurz, die Zeiten, in denen es irgendeine Rolle spielte, wo ein Produkt hergestellt wurde, sind vorbei. Die vermutlich einzige dauerhafte Ausnahme sind Agrarprodukte, deren Qualität vom Boden und vom Klima abhängt; Wein vor allem. Ansonsten kann heutzutage alles nahezu überall hergestellt werden.
Es ist deshalb eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen, daß man - gar durch europäisch-höchstrichterlichen Beschluß - den Feta der Griechen schützt, oder gegebenenfalls den Emmentaler der Emmentaler.
Warum tut man es trotzdem? Warum tut es ausgerechnet die doch so auf Liberalisierung der Märkte bedachte EU? Vermutlich deshalb, weil noch niemand es gewagt, geschweige denn fertiggebracht hätte, den Agrarmarkt zu liberalisieren. Das ist ja im Grunde kein Markt, sondern ein gigantisches protektionistisches Subventionssystem.
In dessen Logik es dann eben auch liegt, eine Produktbezeichnung nicht davon abhängig zu machen, welche Merkmale dieses Produkt hat, sondern in welcher Gegend der EU ihm diese Merkmale verliehen wurden. Man könnte noch einen Schritt weiter - oder vielmehr zurück - gehen und, sagen wir, das feierliche und ewige Privileg verleihen, in einer bestimmten Gegend eine bestimmte Wurst herzustellen oder Sauerkraut zu vergären.
Würde es auch anders gehen, vernünftiger? Ich weiß es nicht. Die Bedürfnisse der Menschen lassen sich, was Industrieprodukte und Dienstleistungen angeht, immer weiter entwickeln, immer mehr steigern, immer subtiler gestalten. Aber beim Essen geht das halt nicht.
Wir haben heute ungleich mehr Unterhaltungselektronik in unseren Wohnungen stehen als noch vor einem halben Jahrhundert. Wir machen weitere und teurere Reisen. Aber essen tun wir immer noch dreimal am Tag. Besser, das ist wahr. Aber nur in Grenzen. Und mehr nach Möglichkeit nicht.
Also fehlt dem Agrarmarkt das, was jeder Markt braucht: Die Möglichkeit unbegrenzter Expansion.
Er ist, paradoxerweise, ein funktioniernder Markt nur zu Zeiten der Unterversorgung. Hat die Produktion erst einmal die Nachfrage eingeholt, dann läßt sich jene nur noch sehr begrenzt weiter steigern. Überproduktion ist die Folge, und diese verlangt Reglementierung, wenn die Landwirtschaft nicht zugrundegehen soll.
Was sie hatten: Erze, Bernstein, Salz beispielsweise. Was sie konnten: Den Bernstein zu Schmuck verarbeiten, das Salz sieden, die Erze verhütten.
Aber auch Schwerter schmieden in Damaskus, die Damaszener. Später Messer schmieden in Solingen, in Sheffield. Kuckucksuhren konstruieren und bauen im Schwarzwald, Gurken einlegen im Spreewald, Offiziersmesser herstellen in der Schweiz, Gruyère herstellen im Wallis, Gouda herstellen in Holland, Schafskäse herstellen im Aveyron, den Roquefort.
Und Schafskäse herstellen in Griechenland, den Feta.
Das alles herzustellen erfordert traditionellerweise große handwerkliche Sachkenntnis, ja Geheimwissen. Dieses wurde ängstlich gehütet; manchmal auch, wenn man Pech hatte, gestohlen. Auch vor Jahrtausenden, vor Jahrhunderten gab es schon eine Wissensgesellschaft; Wissen war immer eine entscheidende Produktivkraft.
Das Wissen um Verfahren, um Rezepturen spielt auch heute noch eine Rolle - sei es in Form der schon fast rührend anmutenden Coca-Cola-Geheimrezeptur, sei es in Gestalt von Patenten, die zwar nicht mehr geheim sind, deren Verwertungsrechte aber ähnliche Vorteile bedeuten wie früher das von Generation zu Generation tradierte Wissen darüber, wie man Schafsmilch zum Roquefort reifen läßt, oder zum Feta.
Zum Feta? Ja, und der ist das Thema dieses Beitrags, oder vielmehr der Salakis. Ich habe ihn vor Jahren in sozusagen zwiefacher Gestalt kennengelernt: Als ein sehr wohlschmeckender Schafskäse, und als Gegenstand einer Geschichte im "Nouvel Observateur".
Der berichtete damals über die Schafzüchter im Aveyron, deren Existenz auf dem Roquefort basiert, der in den Kellern und Höhlen der gleichnamigen Stadt reift. (Ich bin einmal dort gewesen; man riecht den Roquefort buchstäblich Kilometer vor der Stadt.) Sie erzeugen aber seit einiger Zeit, dank verbesserter Methoden und größerer Herden, mehr Schafsmilch, als zu Roquefort verarbeitet werden kann. Da hatten sie eine Idee: Sie verarbeiteten die überschüssige Schafsmilch zu Feta, also zu einem in einer Salzlake liegenden, in Scheiben geschnittenen Schafs-Halbfrischkäse. Und vermarkteten ihn unter der Marke Salakis.
So lernte ich ihn kennen und schätzen. Er ist milder als der bulgarische und korsische Schafskäse, hat aber trotzdem Geschmack und auch die richtige halbfeste Konsistenz. Schnittfest, nicht bröckelnd. Salakis auf frischem Brot, dazu ein paar Tropfen Olivenöl, Pfeffer, Oregano und in feine Scheibchen geschnittener Knoblauch - zusammen mit einem einfachen, kräftigen Wein (weiß oder rot, das ist egal) ist das eine Köstlichkeit, der ich nur wenige Genüsse an die Seite stellen kann.
Nur, Feta ist das demnächst nicht mehr. Griechenland hat erfolgreich geklagt, und mit Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2005, Az. C-465/02, ist es den Bauern des Aveyron, die den Salakis als Kooperative unter der Bezeichnung Feta verkauft hatten, untersagt, das ab 2007 noch zu tun. Der Salakis, den man im Augenblick zu kaufen bekommt, trägt bereits nicht mehr die Bezeichnung "Feta".
Seinem Geschmack hat das, soweit ich erkennen kann, nicht geschadet. So wenig, wie der in Holland erzeugte Emmentaler dadurch schlechter schmeckt, daß er als "Maasdamer" vermarktet wird. So wenig, wie ein Messer aus Chemnitz schlechter ist als eines aus Solingen. So wenig, wie wir noch Salz kaufen, weil aus einer Lüneburger Salzsiederei kommt, oder Pastillen, weil sie in Ems gedreht wurden.
Kurz, die Zeiten, in denen es irgendeine Rolle spielte, wo ein Produkt hergestellt wurde, sind vorbei. Die vermutlich einzige dauerhafte Ausnahme sind Agrarprodukte, deren Qualität vom Boden und vom Klima abhängt; Wein vor allem. Ansonsten kann heutzutage alles nahezu überall hergestellt werden.
Es ist deshalb eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen, daß man - gar durch europäisch-höchstrichterlichen Beschluß - den Feta der Griechen schützt, oder gegebenenfalls den Emmentaler der Emmentaler.
Warum tut man es trotzdem? Warum tut es ausgerechnet die doch so auf Liberalisierung der Märkte bedachte EU? Vermutlich deshalb, weil noch niemand es gewagt, geschweige denn fertiggebracht hätte, den Agrarmarkt zu liberalisieren. Das ist ja im Grunde kein Markt, sondern ein gigantisches protektionistisches Subventionssystem.
In dessen Logik es dann eben auch liegt, eine Produktbezeichnung nicht davon abhängig zu machen, welche Merkmale dieses Produkt hat, sondern in welcher Gegend der EU ihm diese Merkmale verliehen wurden. Man könnte noch einen Schritt weiter - oder vielmehr zurück - gehen und, sagen wir, das feierliche und ewige Privileg verleihen, in einer bestimmten Gegend eine bestimmte Wurst herzustellen oder Sauerkraut zu vergären.
Würde es auch anders gehen, vernünftiger? Ich weiß es nicht. Die Bedürfnisse der Menschen lassen sich, was Industrieprodukte und Dienstleistungen angeht, immer weiter entwickeln, immer mehr steigern, immer subtiler gestalten. Aber beim Essen geht das halt nicht.
Wir haben heute ungleich mehr Unterhaltungselektronik in unseren Wohnungen stehen als noch vor einem halben Jahrhundert. Wir machen weitere und teurere Reisen. Aber essen tun wir immer noch dreimal am Tag. Besser, das ist wahr. Aber nur in Grenzen. Und mehr nach Möglichkeit nicht.
Also fehlt dem Agrarmarkt das, was jeder Markt braucht: Die Möglichkeit unbegrenzter Expansion.
Er ist, paradoxerweise, ein funktioniernder Markt nur zu Zeiten der Unterversorgung. Hat die Produktion erst einmal die Nachfrage eingeholt, dann läßt sich jene nur noch sehr begrenzt weiter steigern. Überproduktion ist die Folge, und diese verlangt Reglementierung, wenn die Landwirtschaft nicht zugrundegehen soll.